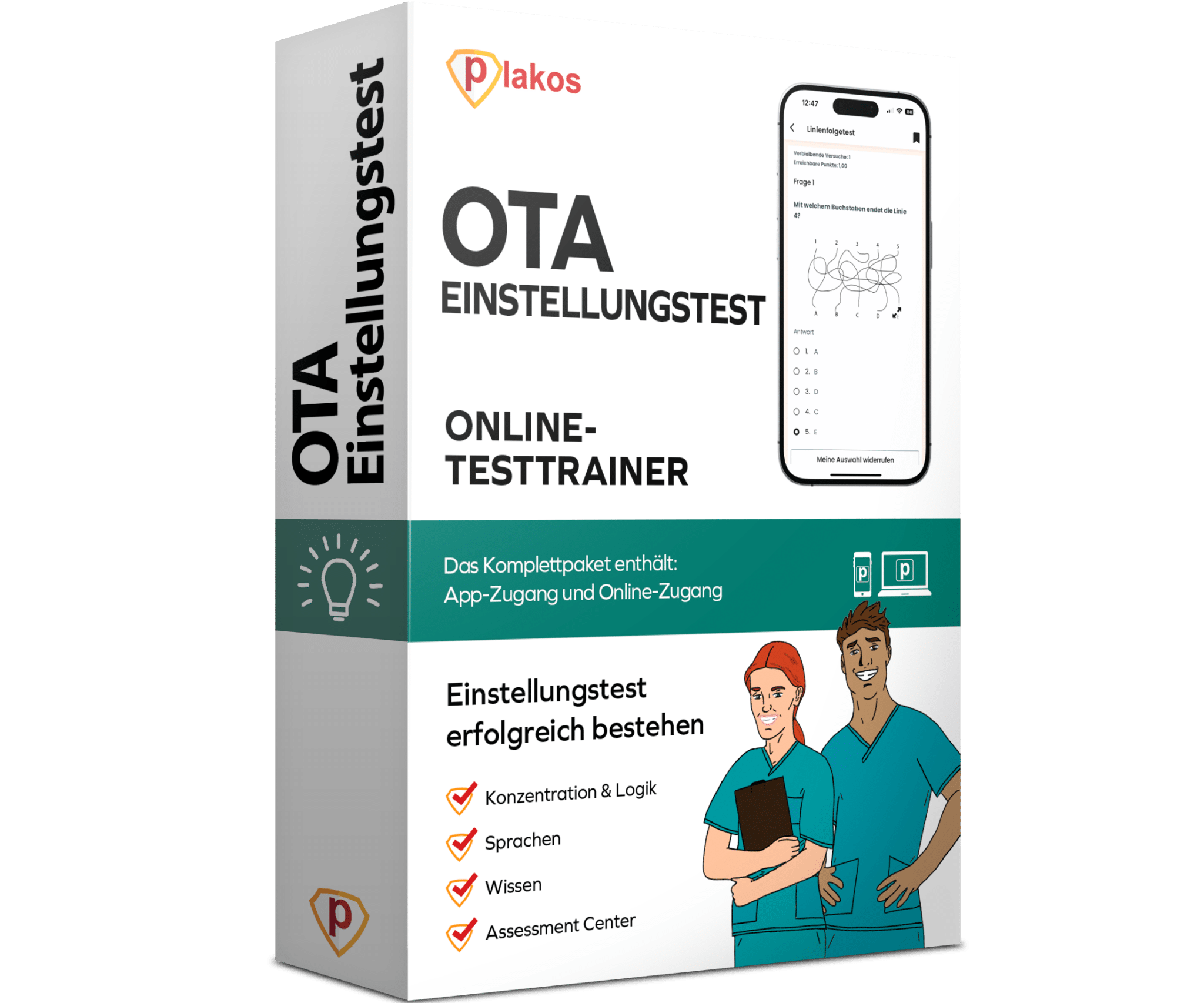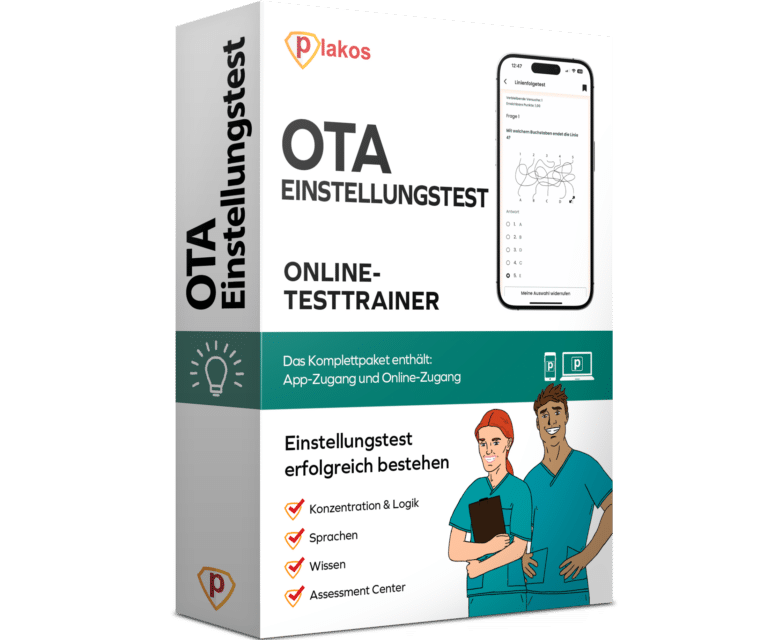Operationstechnischer Assistent (OTA) Einstellungstest: Inhalte, Ablauf & optimale Vorbereitung
Wer an eine Operation denkt, sieht meist Ärztinnen und Ärzte im OP-Saal. Doch ohne einen weiteren, entscheidenden Beruf würde kein Eingriff gelingen: die Operationstechnischen Assistenten (OTA).
Sie sind verantwortlich für das OP-Besteck, die Lagerung der Patientinnen und Patienten, die Vorbereitung des OP-Saals und die Dokumentation – und sie unterstützen das OP-Team aktiv während des Eingriffs.
Wenn du OTA werden möchtest, führt an einem wichtigen Schritt kein Weg vorbei: dem Operationstechnischer Assistent (OTA) Einstellungstest.
Hier erfährst du, wie die Ausbildung aussieht, was im Test auf dich zukommt und wie du dich optimal vorbereiten kannst.
Alles was du wissen musst
OTA-Ausbildung: Dauer, Praxis & Theorie
Die Ausbildung zum Operationstechnischen Assistenten dauert 3 Jahre und besteht aus:
1.600 Stunden Theorie
3.000 Stunden Praxis
In den theoretischen Unterrichtseinheiten lernst du:
medizinisches Grundwissen
Anatomie & Physiologie
Hygiene & Sterilgutversorgung
Grundlagen der Psychologie
Kommunikation & Patientenbetreuung
In der Praxis durchläufst du verschiedene OP-Bereiche wie:
Unfallchirurgie
Gynäkologie
Orthopädie
Allgemeinchirurgie
Notfallmedizin
Dadurch sammelst du bereits während der Ausbildung wertvolle OP-Erfahrung.
FAQ Operationstechnischer Assistent (OTA) Einstellungstest
Der OTA Einstellungstest überprüft zentrale Fähigkeiten, die du später im OP-Alltag benötigst. Dazu zählen vor allem Konzentration, logisches Denken, Mathe-Grundkenntnisse, Merkfähigkeit, aber auch soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Viele Kliniken testen zusätzlich dein Verständnis für medizinische Abläufe.
Der Einstellungstest findet heute häufig online statt. Er besteht meist aus:
Logik- und Konzentrationstests
Mathe-Aufgaben (Grundrechenarten, Maße, Dreisatz)
Sprachverständnis & Rechtschreibung
Situationsaufgaben
Manchmal folgt im Anschluss ein Vorstellungsgespräch oder ein Praxistag im Krankenhaus.
Die effektivste Vorbereitung besteht darin:
täglich 20–40 Minuten zu üben
Mathe- und Logikaufgaben zu wiederholen
Konzentrationstests (z. B. Symbolmarkierung) zu trainieren
Berufswissen über Hygiene, OP-Abläufe und Anatomie anzulesen
Testsimulationen zu nutzen
Der Plakos OTA Testtrainer bietet genau diese Kombination.
Der Test ist gut machbar, aber ungeübt sehr anspruchsvoll. Viele scheitern an:
Zeitdruck
ungewohnten Logikaufgaben
Konzentrationsfehlern
Wer aber gezielt trainiert, besteht den Test in der Regel problemlos.
In den meisten Fällen sind keine Taschenrechner erlaubt.
Rechtschreib- und Grammatik-Tools sind ebenfalls nicht gestattet.
Du solltest daher Kopf rechnen können und grundlegende Matheformeln beherrschen.
Im OP-Saal brauchst du:
Sorgfalt und Genauigkeit
Stressresistenz
schnelle Auffassungsgabe
Teamfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein
Fingerspitzengefühl im Umgang mit Patientinnen und Patienten
Diese Eigenschaften fließen indirekt in den Einstellungstest und das Gespräch ein.
- Interaktive Übungsaufgaben & Lösungen
- Erklärvideos, Erfahrungsberichte & Insidertipps
- Zugang zur Plakos Lern-App
Alles was du wissen musst
Berufsbild OTA – Was erwartet dich?
Als OTA arbeitest du vor, während und nach Operationen im OP-Team.
Deine Aufgaben:
Vorbereiten des OP-Saals
Bereitstellen des richtigen OP-Bestecks
Lagerung der Patientinnen und Patienten
Prüfen der Sterilität
Assistieren als instrumentierende OTA direkt am OP-Tisch
Arbeiten als Springer außerhalb des sterilen Bereichs
Unterstützen bei Notfallsituationen
Dokumentation
Entsorgung & Reinigung
Vorbereitung für die nächste Operation
Teamarbeit, Zuverlässigkeit und Stressresistenz sind dabei essenziell.
Der Operationstechnischer Assistent (OTA) Einstellungstest
Bevor du die Ausbildung beginnen kannst, musst du den OTA Einstellungstest bestehen.
Dieser Test findet häufig online statt und überprüft, ob du die persönliche und fachliche Eignung für diesen verantwortungsvollen Beruf mitbringst.
Die wichtigsten Testbereiche:
Da du im OP präzise arbeiten musst, werden deine Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit geprüft.
Typische Aufgaben:
Fehler in Zahlenreihen finden
Symbole vergleichen
Markierungstests
Im OTA-Einstellungstest werden Logikaufgaben eingesetzt, um zu prüfen, wie gut du Zusammenhänge erkennst.
Beispiele:
Zahlenreihen fortsetzen
Muster erkennen
Schlussfolgerungen treffen
Auch Grundrechenarten werden geprüft, z. B.:
Dreisatz
Prozentrechnung
Maße & Einheiten
einfache Textaufgaben
Besonders wichtig in diesem Beruf:
Sorgfalt
Ausdauer
Teamfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein
psychische Stabilität
Viele Kliniken nutzen Persönlichkeitstests, um diese Kompetenzen zu prüfen.
Erfolgreiche Vorbereitung für den OTA Einstellungstest
Eine gute Vorbereitung entscheidet darüber, wie erfolgreich du beim Test abschneidest.
Die wichtigsten Tipps:
✔️ 1. Frühzeitig trainieren
Starte idealerweise 4–8 Wochen vorher und übe täglich 20–30 Minuten.
✔️ 2. Testsimulationen durchführen
Nur wer die Aufgaben vorher gesehen hat, kann im echten Test schnell reagieren.
✔️ 3. Mathe- und Logikübungen wiederholen
OTA-Tests enthalten viele grundlegende Rechen- und Logikaufgaben.
✔️ 4. Konzentrationsvermögen steigern
Testtrainer helfen, deine Genauigkeit und Ausdauer zu verbessern.
✔️ 5. Berufsspezifisches Wissen aneignen
Ein Grundverständnis von OP-Abläufen ist ein Pluspunkt – auch im Vorstellungsgespräch.
Beispielaufgaben aus dem Kurs
- Aufgabe 01
- Lösung 01
Setze die Reihe sinnvoll fort:
3 – 6 – 12 – 24 – ?
A) 36
B) 44
C) 48
D) 50
Lösung: C (Verdopplung)
- Aufgabe 02
- Lösung 02
Wie viele Millimeter sind 245 cm?
A) 2450 mm
B) 24,5 mm
C) 24500 mm
D) 2405 mm
Lösung: A (1 cm = 10 mm)
- Aufgabe 03
- Lösung 03
Welche Zahl kommt nicht vor?
82 – 84 – 48 – 28 – 82 – 84 – 48 – ?
A) 48
B) 82
C) 28
D) 84
Lösung: C (28 wiederholt sich nicht)
- Aufgabe 04
- Lösung 04
Was wird im OP-Saal als steril bezeichnet?
A) frei von sichtbaren Verschmutzungen
B) vollständig keimfrei
C) nur mit heißem Wasser gereinigt
D) einmal desinfiziert
Lösung: B
Fazit: Mit guter Vorbereitung zum OTA-Ausbildungsplatz
Der Operationstechnischer Assistent (OTA) Einstellungstest ist anspruchsvoll, aber mit der richtigen Vorbereitung absolut machbar.
Wer frühzeitig trainiert, Testsimulationen nutzt und sich intensiv auf die Themen konzentriert, geht mit Sicherheit in den Test – und kann sich schon bald auf die Ausbildung im OP freuen.
Wir wünschen dir viel Erfolg auf deinem Weg zum OTA!